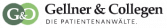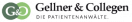Haftet der Arzt für die Fortsetzung künstlicher Ernährung?
Bei Komplikationen im Zusammenhang mit künstlicher Ernährung stellt sich gegebenenfalls die Frage nach der Haftbarkeit des Arztes.
Wegen der künstlichen Ernährung seines unheilbar kranken und dementen Vaters hat dessen Sohn den behandelnden Hausarzt auf ein Schmerzensgeld verklagt. Zusätzlich zu diesem Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 100.000€ wurde der Arzt zudem durch den Angehörigen auf Schadenersatz in Höhe von mehr als 50.000€ verklagt. Der Patient war mehrere Jahre lang über eine Magensonde ernährt worden und starb 2011. Diese Sonde sei spätestens seit 2010 nicht mehr angemessen gewesen, argumentiert der Sohn. Die künstliche Ernährung habe somit das Leiden des Vaters nur verlängert. Die enterale Ernährung über die PEG-Sonde ohne rechtfertigende Indikation stelle einen körperlichen Eingriff und damit einen Behandlungsfehler dar.
Der Beklagte hingegen hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass die künstliche Ernährung indiziert gewesen sei. Demnach habe er den Patienten nach dem Standard einer guten ärztlichen Betreuung versorgt. Zudem sei dieser nicht mit der Frage nach einem Abbruch der Sonderernährung konfrontiert worden.
Wurde die ärztliche Pflicht verletzt?
Das LG München I hat die Klage abgewiesen. Dem Sohn stehe weder hinsichtlich einer Verletzung der ärztlichen Pflichten aus dem Behandlungsvertrag zwischen Vater und Arzt noch nach Deliktsrecht ein ererbter Haftungsanspruch zu.
Die Klageabweisung durch das Gericht stützt sich auf folgende Erwägungen: Zwar habe der Beklagte fehlerhaft nicht auf die spätestens ab Beginn des Jahres 2010 nicht mehr gegebene Indikation für eine Ernährung über die PEG-Sonde hingewiesen. Ist ein über die reine Lebenserhaltung hinausgehendes Therapieziel nicht mehr erreichbar, muss der Arzt eines schwerkranken dementen Patienten dessen Betreuer informieren. Mit diesem muss er besprechen, ob die Weiterführung lebenserhaltender Maßnahmen fortgesetzt werden soll. Die Verletzung dieser Verpflichtung aus § 1901b Abs. 1 BGB stellt einen Behandlungsfehler dar. Auch lebenserhaltende Maßnahmen einschließlich der künstlichen Ernährung stellten – wie alle ärztlichen Eingriffe – rechtfertigungsbedürftige Eingriffe in die körperliche Integrität des Patienten dar. Diese Maßnahme müsste daher sowohl dem Willen des Patienten entsprechen als auch medizinisch indiziert sein.
Dem Gericht zufolge hat allerdings der klagende Sohn den Nachweis dafür, dass dies ursächlich für einen bei seinem Vater eingetretenen Schaden geworden wäre, nicht zu führen vermocht. Eine Haftung für den Verstoß gegen § 1901b BGB setze voraus, dass die Besprechung zwischen Arzt und Betreuer zu der Entscheidung für einen Behandlungsabbruch geführt hätte. Vermutungsregeln könnten diesbezüglich im fundamentalen Bereich des Abbruchs lebenserhaltender Maßnahmen nicht eingreifen.
Wer entscheidet über den Erhalt des Lebens?
Entgegen der Ansicht des Klägers könne nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass eine Behandlung, mit der kein weitergehendes Therapieziel verfolgt werde, im konkreten Fall zweifelsfrei unterlassen werden müsse. Insbesondere da gerade lebenserhaltende Maßnahmen unmittelbar das zentrale und fundamentale Grundrecht auf Leben schützen. Ob dieses Leben „lebenswert“ sei, sei eine höchstpersönliche Entscheidung. Damit erfordere die Frage, ob es erhalten wird, eine konkrete, abwägende Betrachtung im jeweiligen Einzelfall. Diese habe sich an den Voraussetzungen der §§ 1901a, 1901b BGB zu orientieren.
Das Berufungsverfahren ist anhängig.
Landgericht München I, Urteil vom 18.01.2017 – 9 O 5246/14